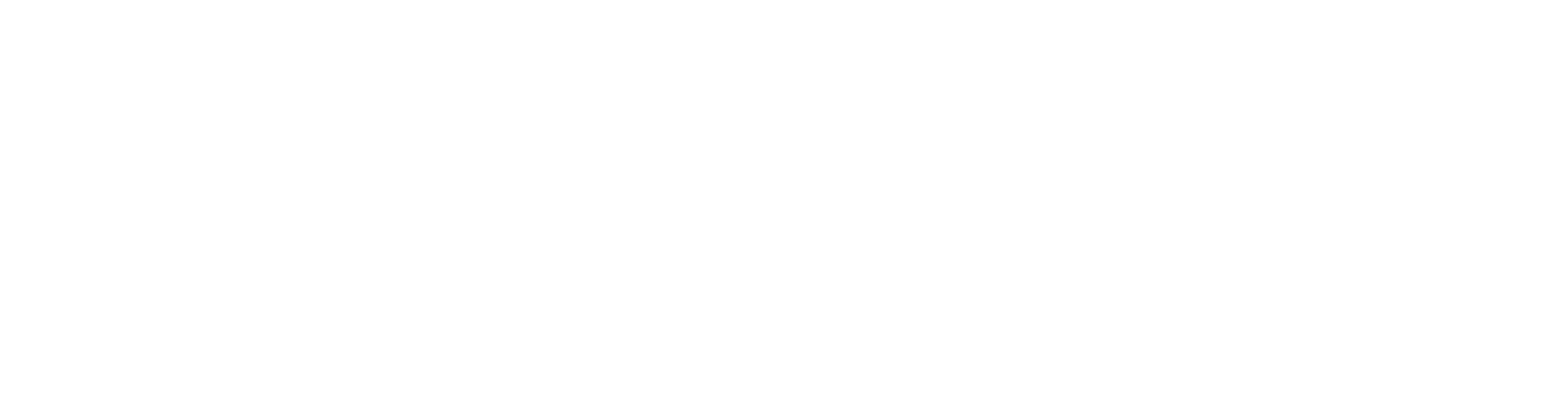Essay
Gerechtigkeit – im Zweifel lieber zweifeln
In Gesprächen mit Freund:innen, in politischen Debatten oder in Gesetzestexten: Das Wort „Gerechtigkeit“ scheint in seiner Definition jedem klar und selbstverständlich zu sein. Doch muss die sogenannte Gerechtigkeit immer wieder neu ausgehandelt und in den Vordergrund gerückt werden. Aber für was steht eigentlich Gerechtigkeit? Wo beginnt sie und wo fehlt sie? Ist Recht gleich Gerechtigkeit? Hannah Hübner und Charlotte Reimers haben sich anlässlich einer Diskussion von Michel Friedman und Ronen Steinke ein paar Gedanken gemacht. Ein philosophischer Essay.
Was ist dem Wort „Gerechtigkeit“ hinzuzufügen? Die Frage klingt simpel, fast schon banal, weil Gerechtigkeit doch in nahezu jeder Bundestagssitzung eine übergeordnete Rolle zu spielen scheint – ein Damoklesschwert, das hinuntersaust, wenn die Forderungen nicht einer gewissen Gerechtigkeit entsprechen. Seit die neue Bundesregierung im Amt ist, findet man in jedem der 18 Bundestagsprotokolle das Wort Gerechtigkeit, in Protokoll vier etwa 32 Mal. Doris Achelwilm von den Linken fordert: „Das ist Geld, das wir für mehr Gerechtigkeit und soziale Maßnahmen, zum Beispiel gegen Kinderarmut, dringend brauchen und wiederhaben wollen“ (Sitzung 4).
Carmen Wegge, SPD bekräftigt: „Jeder Mensch in unserem Land muss eine Wohnung finden und sie auch bezahlen können, das ist eine Frage der Gerechtigkeit (Sitzung 14). Oliver Pöpsel, CDU: „Ich möchte nur mit Nachdruck betonen, dass die Investitionen in Ausbau und Qualität der Kitas und Ganztagsangebote nicht nur einen Beitrag zur Bildungs- und Startchancengerechtigkeit der Kinder und Jugendlichen ganz konkret vor Ort leisten“ (Sitzung 18). Leon Eckert, Grüne: „Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, diese Ungerechtigkeit zu beenden” (Sitzung 17). Diana Zimmer, AfD: „Es ist eine Umverteilungsfantasie, die sich in Eigentumsfeindlichkeit und Umverpackung als Gerechtigkeit tarnt“ (Sitzung 14). In jeder vorgetragenen Rede – ausnahmslos von jeder Partei – wird diese Beteuerung in den Raum geworfen. Mögen die Forderungen vernünftig oder aber noch so entleert und weltfremd wirken, zumindest gerecht mögen sie doch bitte sein.
Von Menschenhand gemacht
Vermutlich würde jede Partei für sich reklamieren wollen, die „eine Gerechtigkeitspartei“ sein. Die Deutungshoheit über dieses bedeutungsvolle Wort besetzen zu können, würde aber deren Sinn entbehren, denn Gerechtigkeit, so der Jurist und Süddeutsche Zeitung Autor Ronen Steinke, müsse immer wieder neu ausgehandelt werden. Sie ist kein Naturzustand, schon gar nicht apodiktisch in Holz gekerbt, sondern ein menschengemachtes von unterschiedlichen Definitionen geprägtes Abstraktum. Bereits der erste Einwurf Steinkes bei der Diskussion mit Michel Friedmann (in den Münchner Kammerspielen am 06. Juni 2025) hilft, um das Dickicht Gerechtigkeit lichter werden zu lassen. Die zwischenmenschliche Gerechtigkeit hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass am Geburtstag meiner Nachbarin schönes Wetter ist und es bei meiner eigenen Grillparty aus Kübeln schüttet. Auch nicht, dass eine 22-Jährige an einem bösartigen Herzinfarkt stirbt und eine andere noch mit 100 Jahren ihre Pflanzen im Garten voller Tatendrang hegt und pflegt. Diese Dinge sind tragisch – aber sie sind nicht unmittelbar ungerecht. Ungerechtigkeit streckt seine Kapillaren dort in Gefäße der Gesellschaft, wo Menschen aufeinandertreffen, wo sie einander schulden, Entscheidungen treffen, ja gar über Chancen, Ressourcen und Verteilung abstimmen. Bedeutet: Gerechtigkeit ist kein Determinismus, sondern eine ständig neu austarierte Idee, eine Aufforderung, die ihresgleichen sucht – worin auch das Problem liegen kann.
Recht haben oder Gerechtigkeit?
Wer dachte, ein Blick in Gesetzestexte genügt, um klarer zu sehen, täuscht sich. „Recht zu haben ist schonmal besser und gerechter…als kein Recht zu haben. Aber noch keine hinreichende Voraussetzung dafür” (Zitat: Ronen Steinke). So geschehen bei den Nürnberger Rassengesetzen, eine „in Paragrafen gegossene Menschenverachtung“. Rechtens – aber keinesfalls moralisch legitim. So wie in den 50er und 60er Jahren, als Taschendiebe flugs heftige Strafen auferlegt bekamen, gleichzeitig aber Täter der Shoah unbehelligt durch die Städte schlenderten. Die Justiz arbeitete in Windeseile dicke Akten von Kavaliersdelikten ab, aber nicht die der schlimmsten Verbrecher des 2. Weltkriegs und des Holocausts und sendete damit implizit eine deutlich obszöne Botschaft: Mehr als ein Achselzucken ist nicht drin. Und auch, wenn sich bis heute einiges geändert hat, ist immer noch derjenige im Vorteil, dessen Anwalt eloquenter “mein Mandant kann sich nicht erinnern” sagen kann. Justizia bemisst sich eben nicht an Paragrafen, sondern an denen, die sie erreicht.
Schafft das Grundgesetz Abhilfe?
Wer die weltweit am häufigsten genutzte Enzyklopädie – Wikipedia – aufschlägt, erhält folgende Information: „Gerechtigkeit wird weltweit als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet; daher berufen sich in fast allen Staaten Gesetzgebung und Rechtsprechung auf sie. Ähm ja, eher „ein Versprechen, das nicht vollständig eingelöst ist” sagt Ronen Steinke. Das Wesen der Gerechtigkeit ergebe sich aus der Unwesentlichkeit welcher Herkunft, welchen Geschlechts, Religion oder welcher Einkommensgruppe der Mensch angehöre. Auf dem Papier mag das mas o menos stimmen, de facto aber sitzen aktuell zehn Prozent aller Gefängnisinsass:innen – das entspricht etwa 56.000 Menschen in Deutschland in Haft – weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen können und stattdessen eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Das gilt zum Beispiel für Schwarzfahrer, die nach mehrmaligem Nutzen des ÖPNV ohne Ticket zu einer Geldstrafe verurteilt wurden und nun für zum Teil mehrere Monate hinter Gitter kommen. In Gefängnissen, von denen man meinen könnte, dass hier nur Schwerverbrecher ihre Zeit absitzen sollten. Nun erscheint es durchaus naheliegend, dass gerade Menschen, die eine Fahrkarte nicht zahlen können, auch eine später deswegen verhängte Geldstrafe nicht zahlen können (paradox an dieser Stelle auch, dass ein Monat Gefängnis für die Steuerzahler etwas mehr als 3.200 Euro kostet). Die Ersatzfreiheitsstrafe diskriminiert auf diese Weise einkommens- und vermögensschwache Menschen. So finden sich etwa Wohnungslose, Arbeitslose und Suchtkranke besonders häufig wegen Bagatelldelikten im Gefängnis. Aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit, ja womöglich sogar aus rechtsstaatlicher Sicht, könnte das problematisch sein – immerhin Freiheitsentziehung, in Fällen, in denen gerade festgestellt wurde, dass eine Freiheitsstrafe nicht unbedingt angemessen ist.
Eine Frage der Einkommensverteilung
Bei der Frage, wer Geldstrafen bezahlen kann oder wer bessere Bildungschancen hat, lässt sich oft ein Zusammenhang mit der Schere zwischen Arm und Reich erkennen. Zehn Prozent der reichsten Haushalte in Deutschland besitzen 60 Prozent des Gesamtvermögens. Diese können sich aufgrund ihrer besser gestellten finanziellen Lage etwa leichter Nachhilfe für ihre Kinder organisieren und leben länger, die reichsten fünf Prozent ganze zehn Jahre länger als die ärmsten fünf Prozent. Ungerechtigkeit als Perpetuum Mobile. Auch das vorher genannte Beispiel der Frau, die mit 22 einem Herzinfarkt erlag, ist nur so lange ein unpolitisches, von Ungerechtigkeit unberührtes Thema, wenn durch spezifischere medizinische Gendermedizin und mehr Aufklärung der Tod nicht hätte verhindert werden können.
Fairness-Konzept
Doch wie der auf politischer Ebene getrimmten Ungerechtigkeit Einhalt gebieten? Wie Marcel Fritscher in einem Essay aus dem Jahre 2018 festhält, haben Menschen schließlich unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Wer nach einer allgemein gültigen Definition sucht, wird nicht mehr als ein zersplitternden Holzscheitel in die Finger kriegen, an dem man sich im besten Fall krallen kann. Ein von John Rawls vorgeschlagenes simples Konzept mit dem kohärenten Titel “Gerechtigkeit als Fairness” kann die sogenannte Gerechtigkeit aber zumindest versinnbildlichen: Der Schleier des Nichtwissens – eine Gruppe an unterschiedlichsten Menschen und mit unterschiedlichen Privilegen müsste sich auf neue Regeln in einer Gesellschaftsordnung einigen, ohne zu wissen, welcher Bedingungen am Ende ihre eigenen sind. Keiner wird wissen, wohin er katapultiert wird – ins Eldorado oder in prekäre Verhältnisse. Rawls war überzeugt: Kein Mensch würde mit schlechteren Startbedingungen ins Leben stolpern, nur damit sich andere bei ihrem leichtfüßigen Sprint die Taschen voller stopfen können. Eine Ordnung ist dann gerecht, wenn man ihr dann auch zustimmen würde, wenn man zu den am wenigsten Begünstigten zählen würde. Gerechtigkeit ist keine statische Deskription unterschiedlicher Verhältnisse und Prozesse, sondern ein Charakteristikum moralischer Erträglichkeit.
Ein sich ständig wandelndes System
Gerechtigkeit stellt man sich vielleicht als ein Tausendsassa mit schwarzem Rollkragenpulli vor, einer Hornbrille mit dicken Gläsern, die immer ein Stück zu weit unten auf der Nase sitzt, ein prüfender Blick, der alles und jeden ständig auf gerechte Verteilung abklopft. Vielleicht liegt der Fehler also schon in der Betrachtung von Gerechtigkeit. Sie darf nicht als eine harmoniebedürftige und immer präsente Personifikation wirken, sondern muss ausgestattet sein, mit Stacheln und einen Werkzeugkasten, der den Zufall entwaffnen kann. Gerechtigkeit darf nicht als kleine Fußnote in Gesetzestexten durchschimmern, sondern muss die Machtfrage immer im Blick behalten. Gerade weil sie so fragil ist, darf sie nicht interessensgeleitet sein, vielmehr muss sie das Individuum vor einer Unmündigkeit des Kollektivs schützen. Ein Seismograf, der keine perfekte Welt verspricht, aber eine, in der ungewollte Unterschiede über Lebensverhältnisse nicht als feststehendes par ordre du mufti geordnetes Naturgesetz gelten, sondern als Justierschrauben, die politisch festgenagelt, modelliert und im Zweifel um sehr viele Grad gedreht werden können. Das ist nicht viel verlangt – aber auch nicht wenig.
*Bis auf das sechste Protokoll, hier findet sich das Wort Gerechtigkeit als solches nicht, aber Dinge werden etwas oder jemandem „gerecht“.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeit
https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle
https://www.strafrechtsiegen.de/ersatzfreiheitsstrafe-im-deutschen-strafrecht/
https://www.deutschlandfunk.de/strafrecht-geldstrafe-gefaengnis-ersatzfreiheitsstrafe-100.html
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ungleichheit-kostet-lebensjahre-8234.htm